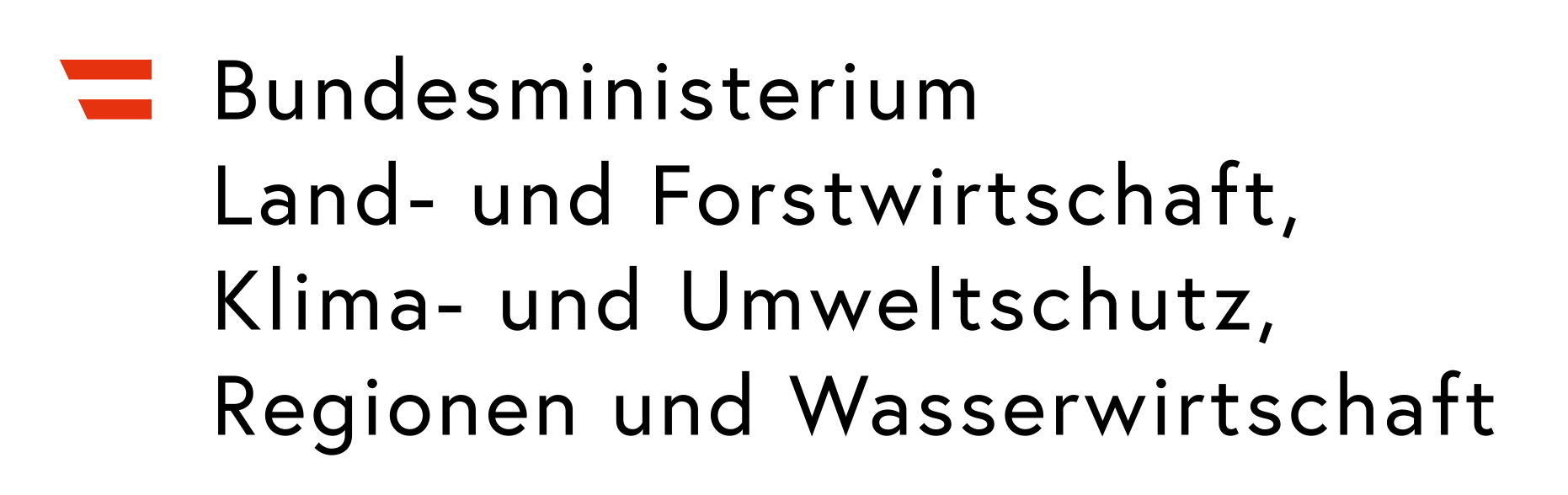Die hier vorgestellte Arbeit präsentiert die Auswertung der flächendeckenden Waldinventur im Rahmen des Projektes "Naturrauminventur im Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal 2024-2025)". Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einem Wildnisgebiet, welches den strengen Kriterien der Weltnaturschutzorganisation IUCN und den ebenso strengen Kriterien eines UNESCO Weltnaturerbes unterliegt, andere Maßstäbe anzusetzen sind als in Wirtschaftswäldern.
Die Datenerhebung, Verarbeitung und Auswertung wurden im Zuge eines Auftrages durch die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) durchgeführt. Der Erhebungsraster der ÖBf wurde deutlich verdichtet und erstmals auf das gesamte Gebiet ausgeweitet. Methodisch orientiert sich die Erhebung am traditionellen ÖBf-Schema, wurde jedoch um zusätzliche Parameter ergänzt, die für ein Prozessschutzgebiet besonders relevant sind – etwa Merkmale der Biodiversität, Strukturvielfalt, Baumarten- und Verjüngungszusammensetzung, Wildeinfluss sowie Totholzvorräte.
Vier Teilgebiete mit unterschiedlicher Nutzungsgeschichte
Es wurden vier Teilgebiete ausgeschieden, die sich hinsichtlich der Dauer der Außernutzungsstellung unterscheiden:
- Urwald Rothwald: seit seiner Entstehung nach der letzten Eiszeit keine flächige Nutzung, einer der letzten Urwaldreste Europas und die größte zusammenhängende Urwaldfläche des gesamten Alpenbogens.
- Neuhaus: Probepunkte, die die "Erste Generation nach Urwald" repräsentieren. Der intern benannte "Lahnwald" wurde vor ca. 250 Jahren flächig genutzt und nie aufgeforstet.
- Dürrenstein: Fläche im niederösterreichischen Teil des Wildnisgebietes, die seit der Gründung vor 25 Jahren, teils bereits länger, teils erst ab 2013 durch die ÖBf aus der Nutzung genommen wurde.
- Lassingtal: steirische Erweiterungsfläche der ÖBf, die 2021 hinzugekommen ist.
Mit Ausnahme des Urwaldes wurden alle Flächen zumindest einmal forstlich genutzt, teilweise unmittelbar bis zur Außernutzungsstellung. Diese unterschiedliche Nutzungsgeschichte spiegelt sich deutlich in nahezu allen erhobenen Kennwerten wider - etwa in Totholzvorräten, Bestandesstrukturen oder Mikrohabitaten.
.jpg)
Verbiss im Wildnisgebiet
Das Thema Verbiss ist ein kontrovers diskutiertes Thema - sowohl in der Forstwirtschaft als auch im Naturschutz. Für ein Prozessschutzgebiet der Kategorie I nach IUCN, wie dem Wildnisgebiet, zählt in diesem Zusammenhang ausschließlich, ob die Waldgesellschaften in ihrer Gesamtheit gefährdet sind, oder nicht. Im Wildnisgebiet geht es nicht um die Produktion von Wertholz oder die Erhaltung eines bestimmten Zustandes, sondern darum, dass sich natürliche Waldgemeinschaften frei entwickeln und auf natürliche Gegebenheiten ohne Zutun des Menschen reagieren können. Das betrifft z.B. den Verbiss durch Huftiere aber beispielsweise auch den menschengemachten Klimawandel und dessen Auswirkungen.
Die Inventur zeigt: Nur etwa ein Drittel der Jungpflanzen weist Verbiss auf.
Wichtig: Verbiss bedeutet nicht gleich, dass die Bäume absterben. Viele stark verbissene Jungbäume überleben und wachsen später aus dem Äser heraus. Wichtig ist nur, dass genügend Individuen ein fruktifikationsfähiges Alter erreichen. Zeit spielt dabei keine Rolle. In Urwäldern stehen Bäume oft 100 Jahre oder mehr unter Druck bzw. im Schatten anderer Bäume. Erst der Tod eines Baumriesen lässt genug Licht einfallen, sodass dieser unterständige Baum bis in die Oberschicht zu wachsen beginnen kann.
Auch besonders sensible Lebensräume wie der Urwald Rothwald weisen derzeit keine Bestandesgefährdung auf. Das gilt ebenfalls für die Tanne, jene Baumart, die aktuell in ganz Österreich Expert*innen Sorge bereitet und deren Verbiss im Gebiet bei rund 30% liegt - ein Wert, der zwar relevant ist, aber keine flächige Gefährdung anzeigt. Trotzdem verzeichnet die Tanne großflächig über das Wildnsigebiet hinaus Probleme bei der Vermehrung. Das Wildnisgebiet würde sich hervorragend anbieten, verschiedene Einflussfaktoren auf dieses Phänomen zu erfassen und daraus Rückschlüsse zu ziehen, die auch der Forstwirtschaft nützlich sein können.
Dickungsphase - Unterschiede zwischen Baumarten
Die Dickungsphase zeigt eine andere Baumartenzusammensetzung als die Naturverjüngung.
Auffällig sind:
- ein starker Rückgang des Bergahorns
- geringe Anteile von Tanne und Esche
- ein klarer Schwerpunkt der Buche, gefolgt von Fichte.
--> die Vielfalt der Naturverjüngung geht nur eingeschränkt in die nächste Entwicklungsphase über.
Standortfaktoren und -ansprüche der einzelnen Baumarten spielen hier eine große Rolle: Schattentolerante Arten wie die Rotbuche kommen besser zurecht, während lichtliebende Arten wie Esche oder Bergahorn häufiger zurückfallen. Die Tanne nimmt auch hier eine besondere Stellung ein - sie kommt in der Verjüngung vor, fehlt aber später in der Dickung häufiger, was auf weitere hemmende Faktoren, zusätzlich zum Verbiss, hinweist.
Die Flächen Urwald Rothwald und Neuhaus weisen generell ein um ein Vielfach höheres Dickungsstadium auf als die anderen Flächen.
Wildeinfluss durch Schälung - ein anderer Blick als im Wirtschaftswald
In einem nutzungsfreien Gebiet stellt die Schälung keinen Schaden dar und ist als natürlicher Prozess anzusehen, daher wird von Wildeinfluss durch Schälung gesprochen. Interessant ist dieser Einfluss trotzdem - er muss nur anders interpretiert werden. Zum Beispiel entstehen durch Schälungen neue Habitate für Organismen wie Pilze.
Die Inventur zeigt:
- kaum frische Schälungen
- Schälungen hauptsächlich bei Fichten mit einem Durchmesser von 10 bis 30 cm
- die Gebiete Dürrenstein und Lassingtal weisen besonders viele Alt-Schäle auf (Zusammenhang mit historischer jagdlicher und forstlicher Nutzung.
Das hohe Vorkommen alter Schäle führt zu erhöhter Totholzbildung, was ein positiver Effekt für die Biodiversität und den Strukturreichtum sowie der Entwicklung hin zu naturnäheren Bedingungen im Wildnisgebiet darstellt.
Totholz - ein Schlüsselindikator für Biodiversität
Das stehende Totholz im Wildnisgebiet erreicht durchschnittlich ein Volumen 33,6 Vfm/ha und weist somit deutlich mehr als Wirtschaftswälder auf. Besonders der Urwald zeichnet sich durch ein breites Dimensionsspektrum aus - inklusive sehr alter und großer Buchen, Fichten und Tannen, mit Durchmessern von über 80 cm. Besonders Tannentotholz in großer Dimension ist hier verfügbar - ein großer Unterschied zu den restlichen Flächen. Dies schafft einen Lebensraum für hochspezialisierte Arten, etwa den extrem seltenen Hyazintenduft-Feuerschwamm (Phellinidium pouzarii), der europaweit aktuell nur neunmal nachgewiesen wurde.
Beim liegenden Totholz wurden für die Messung zwei Methoden angewandt (Transekt vs. Vollaufnahme). Beide Methoden zeigen ähnliche Trends, aber deutliche Unterschiede bei den absoluten Mengen, weshalb Methodenvergleiche vorsichtig zu interpretieren sind. Die Vollaufnahme ergibt 70,5 m³/ha liegendes Totholz im gesamten Gebiet, die höchsten Mengen liegen mit rund 229 m³/ha im Urwald. Den meisten Totholzanteil macht die Fichte aus, gefolgt von der Buche.
Nicht nur die starke Dimension, auch die Vielfalt der Baumarten und unterschiedliche Zersetzungsstufen zeigen den hohen ökologischen Wert des Urwaldes und weisen auf eine lange und ungestörte Waldentwicklung hin.

%20(1).jpg)
Altbäume - Hotspots der Biodiversität
Altbäume wurden ergänzend zur Inventur erfasst, da sie für zahlreiche Arten essenziell sind. Sie bieten etwa Mikrohabitate wie Höhlen, Faulstellen, Astabbrüche oder Rindentaschen und sind ein langwährender Lebensraum für z.B. xylobionte Käfer, Spechte und auch Fledermäuse. Die höchsten Dichten an Altbäumen finden sich erwartungsgemäß im Urwald (1,1 m²/ha), gefolgt von Neuhaus (0,7 m²/ha). Die "jungen" Flächen Lassingtal und Dürrenstein haben (noch) so wenig besondere Altbäume, dass die Grundfläche am Hektar mit 0 m² ausfällt. Dies verdeutlicht wieder den herausragenden Wert von Urwäldern und alten Wäldern für die Biodiversität.
Mit zunehmenden Brusthöhendurchmesser (BHD) steigt auch die Mikrohabitatausstattung: Während dünne Bäume kaum Mikrohabitate besitzen, tragen Bäume über 70 cm BHD in fast der Hälfte der Fälle mehrere Strukturen.
Struktur- und Artenvielfalt - klare Dominanz des Urwaldes
Auch beim Arten- und Strukturindex liegt der Urwald klar vor allen anderen Gebieten. Neuhaus zeigt eine Mischung aus urwaldähnlichen Teilflächen und weniger strukturierten Bereichen. Dürrenstein und Lassingtal liegen im mittleren Bereich, weisen aber ebenfalls hochwertige Einzelbereiche auf.
Fazit
Die Ergebnisse zeigen deutlich:
Die Wälder des Wildnisgebietes außerhalb des Urwaldes entwickeln sich zunehmend in Richtung urwaldähnlicher Strukturen - ein Prozess, der jedoch noch Jahrzehnte bis Jahrhunderte in Anspruch nehmen wird. Die Außernutzungsstellung spiegelt sich, wenn auch in unterschiedlichen Gradienten, auf allen Flächen wider.
Dieses Projekt wird durch den Biodiversitätsfonds des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft gefördert.